Zum zwanzigjährigen Jubiläum von Kultur macht Schule haben wir von der Geheimen Dramaturgischen Gesellschaft einen Fachtag ausgerichtet, der nicht nur das Vergangene feiern sollte, sondern an dem von den Teilnehmenden auch eine bunte und doch ziemlich konkrete Wunschliste für die kommenden Jahre erstellt wurde. Beim Klemmbausteine Zusammensetzen, Spazieren, Summen und Diskutieren kamen einige Themen auf, die in ihrer Gänze zu beleuchten ich an dieser Stelle nicht in der Lage wäre. Geld braucht man, klar, und doch ist dieses ewige nicht das einzige Thema. Dieser Artikel soll nun also ein anderes haben: Kultur und Schule – wie geht das zusammen? Wie geht es gegeneinander und wie darf es gegeneinander gehen? Und: Wie kann es nebeneinander stehen?
Der scheinbaren Abstraktheit dieser Formulierungen steht ein metaphorisches Bild entgegen: Eine teilnehmende Person formulierte ihre Vision so: „In den Schulen ist Kultur macht Schule im Bewusstsein der Schulleitung verankert → Weiterbildung oder Kulturagenten, die das Feuer unterhalten und vergrössern.“ Das Feuer – ist das Kultur? Sind die Kulturschaffenden also Brandstiftende, die die Schulkinder zu Pyromaninnen und Pyromanen heranziehen? Und wäre, in der Folge gedacht, ein vergrössertes Feuer, vielleicht gerade eben noch ein lauschiges Lagerfeuer, auf dem besten Weg, ein Flächenbrand zu werden? Wer will schon einen Flächenbrand an seiner Schule?
Dem metaphorischen Bild steht ein konkretes entgegen: In einem Video, das beim Jubiläum gezeigt wurde und in dem das Projekt Raumlabor porträtiert wird, sieht man Kinder in den Räumen der Künstlerin wild mit roter Farbe arbeiten, die in fröhlichen Flecken auf dem Boden landet1. Nur handelt es sich bei den Räumen der Künstlerin eigentlich um Schulräume. Es müsste nun also doch das Gesetz der Schule greifen, so etwas wie eine Hausordnung, eine Regelung für Sachbeschädigung und Verantwortungsbewusstsein. Aber auch: Ein Widerspruch und ein Eingriff. Eben noch frei, kreativ, selbstbestimmt – und nun schon wieder eingeschränkt.

Symptome des Anfangs
Freiheit, Regelbruch, Chaos, eigener Ausdruck. Das alles sind Dinge, die Kunst zugeschrieben werden und die auch Kultur macht Schule verspricht. Inwiefern kann Kunst ihren subversiven Charakter behalten, wenn sie in die Normen und Regeln einer Schule eingebunden ist? Es sind ja eben doch keine weissen Blätter und leeren Räume, sondern Schulblöcke und Klassenzimmer. Doch das explosive Potenzial aller Künste, nicht nur der bildenden, muss vermittelt werden, auch dort, wo keine Explosion stattfinden soll oder darf.
Mit professionellen Künstlern kommen hier Menschen an die Schule, die das Gefühl der Entwurzelung kennen und das Problem des Anfangs, das Ertragen des inneren Chaos, das Suchen nach einer Verankerung, das Ausprobieren, Verwerfen, Sich-Entscheiden für eine Form, das Verantworten dieser Entscheidung. Gerade für Jugendliche, die sich dem inneren Chaos in so hohem Masse ausgeliefert fühlen, ist es von grundlegender Bedeutung, Erwachsene zu erleben, die es vermögen, das Chaos als Symptom des Anfangs zu entlarven.
(Kagerer 1991: 592f.)2
Allein in der Herangehensweise bleibt der künstlerische Raum also ein nicht-schulischer. Anfang und Chaos statt Abschluss und Klarheit. Wobei natürlich die Frage ist, ob der herkömmliche Lehrplan tatsächlich so etwas wie Klarheit liefert, selbst wenn man damit seinen Abschluss macht. Ist es nicht gleichzeitig die Entlarvung der Erwachsenen, die man in der Schule erlebt, während man selbst erwachsen wird? Ich erinnere mich noch gut an mein eigenes Gefühl, dass Erwachsensein ein Reinfall ist. Dass Lehrende nicht alle Universalgenies sind, und der Deutschlehrer schon an der Matheaufgabe der nächsten Stunde scheitern würde. Dass Menschen durch ihr Leben gehen, ohne die Tagesschau zu gucken. Dass Literatur mit Deutschunterricht nur am Rande etwas zu tun hat. Dass da vorne Menschen stehen, mit ihren eigenen Unsicherheiten, speziellen Interessen, witzigen Eigenheiten und peinlichen Momenten, einfach Menschen, mit mehr Erfahrung auf der Erde, ja, aber doch fürs Menschsein genauso Experten und Expertinnen wie die Siebzehnjährigen in den Schulreihen vor ihnen. (Von meinem siebzehnjährigen Ich hätte ich sowieso noch einiges zu lernen, doch das ist ein Thema für einen anderen Text.)

Von links: Robert Ziesenis, Ariana Emminghaus und Vincent Kresse. © Donovan Wyrsch
Die Perspektive einer Auf- und Abgehenden
Kunstschaffende haben mit Sicherheit nicht irgendeine Expertise fürs Menschsein, die einer Lehrperson unzugänglich wäre. Ganz sicher könnten sich beide darin bestens ergänzen und noch sicherer gibt es überhaupt nicht DIE Künstlerperson und DIE Lehrperson. Und doch ist die gesamte Existenz nicht nur des Kunstschaffenden, sondern der Kunst selbst, in ihrer gebündelten Energie und potenziellen Schlagkraft, eine befreiende Erfahrung. Das eingangs erwähnte Subversive und das eben zitierte Chaos als Symptom des Anfangs, all das ist wie ein Versprechen nach dem Reinfall. Dass sich das Erwachsensein doch lohnt, weil es in dem Erwachsensein ein Kindsein gibt.
Man nötigt euch in der Schule eifrig von der Unter- über die Mittel- zur Oberstufe. Wenn ihr schliesslich droben steht und balanciert, sägt man die „überflüssig“ gewordenen Stufen hinter euch ab, und nun könnt ihr nicht mehr zurück! Aber müsste man nicht in seinem Leben wie in einem Hause treppauf und treppab gehen können?
(Erich Kästner, Ansprache zum Schulbeginn, 1950)3
Aus der Perspektive einer Auf- und Abgehenden kann ich sagen, dass gerade das Paradox der Kultur in der Schule eine besonders gelungene Abbildung meiner Lebensrealität ist. In gewisser Weise entspricht das Auftreten der Kulturschaffenden in der Kulturpolitik dem einer Schülerin oder eines Schülers in der Schule. Ja, auf den Boden dürfen Flecken, aber nur, wenn der Boden bezahlt ist oder die Fördermittel für Putzmassnahmen bewilligt sind. Ja, es gibt keine Noten, aber es gibt Förderbescheide und Arbeitsverträge, es gibt Antragstexte, Exposés und Konzepte, die nur wenig mit dem zu tun haben, was ich eigentlich unter „Schreiben“ verstehe. Doch es bleibt eine mindestens finanzielle Notwendigkeit, mich innerhalb einer gewissen Hausordnung zu bewegen, um weiterzuarbeiten.
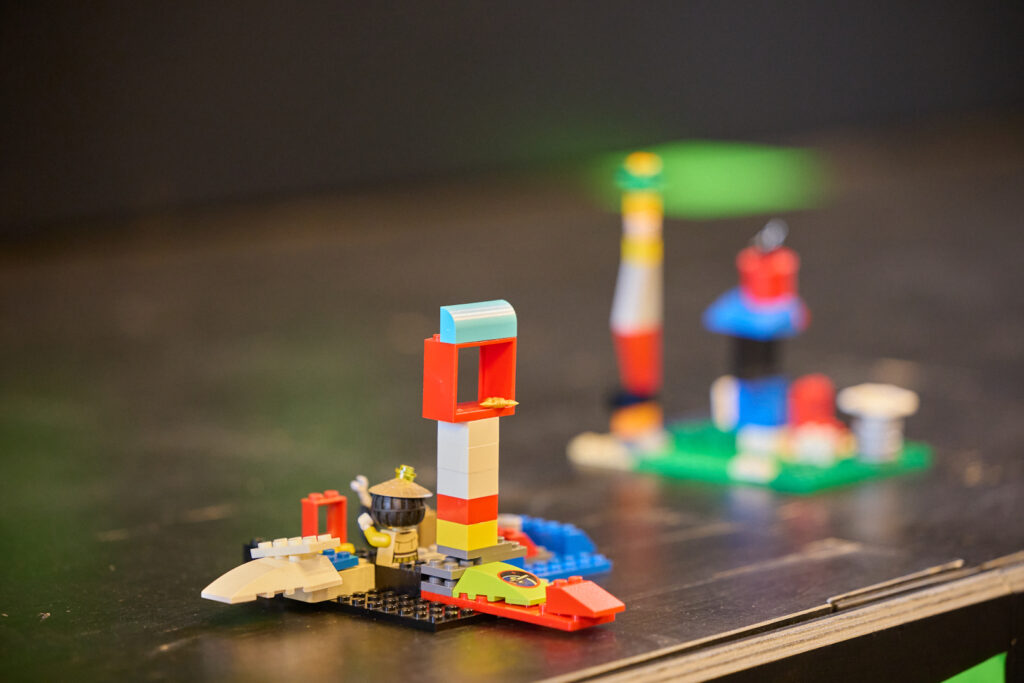
Die freien Künste und die dienenden Künste
Sind ausserdem Lehrpersonen nicht auch weit mehr als Menschen, die „auf der obersten Stufe, ohne Treppe und ohne Haus [stehen], und […] sich wichtig machen“4? Dass Pädagogik keine reine Wissenschaft ist, sondern auch eine Kunst für sich, müsste leicht zu verstehen sein. Und doch gibt es einen Unterschied:
Die Kunst der Schule gehört nicht zu den freien, sondern zu den dienenden Künsten. Nicht das Werk und die Autonomie von Wahrnehmung, Ausdruck, Gestaltung, Darstellung bilden das Ziel, sondern die Subjektivität und die Autonomie der Schüler.
(Liebau 2009: 54)5
Immer wieder wird in der Argumentation für Kultur an der Schule so etwas wie ein Leistungs- und Lerngedanke gepriesen: Diese künstlerische Annäherung hat die Deutschlektüre erleichtert, jener kreative Ansatz hat beim Lernen geholfen. In dem Kontext der dienenden Kunst ergibt das vollkommen Sinn. Es ist ein Beispiel dafür, wie sich Schule und Kultur, womöglich sogar unfreiwillig, ergänzen und bereichern. Doch das darf nicht die ausschlaggebende Argumentation für Kultur an der Schule sein, würde es doch die künstlerischen Ziele denen der schulischen Leistung unterordnen, würden sie doch dadurch ganz vereinnahmt. Nur da, wo Kunst in seiner ganzen Freiheit sein darf, kann sie eine tatsächliche Alternative zum Schulalltag bieten anstatt einer schlecht verschleierten Lernmassnahme.

Nicht mehr nur geduldet
„An vielen Schulen wird kulturelle Bildung gefördert, an anderen nur geduldet“, sagt Sabine Weissenberg, Vertreterin des Kulturamtes der Stadt Herten und Kooperationspartnerin im Projekt „Kunstwege zur Integration“6. Ein völlig anderer Standort als der Kanton Aargau. Hier hiess es ja in dem eingangs zitierten handgeschriebenen Feedback: „In den Schulen ist Kultur macht Schule im Bewusstsein der Schulleitung verankert.“ Und doch wird eine Forderung laut, nach Kulturagenten, Kulturagentinnen und Weiterbildungen. Ebenfalls enorm viel Zustimmung haben beim Jubiläum Ideen für „Impulsveranstaltungen für Schulleitende“ bekommen, auch Vorschläge für „mehr Kultur in der Ausbildung an der PH“ oder „Kulturtage statt nur Sporttage“ kamen auf.

Eine Richtlinie, die sich durch diese Vorschläge zieht, ist die vermehrte Einbindung von Lehrkräften und Schulleitung. Nicht als Lehrende, sondern als Lernende. Denn sie mögen sich in ihrer dienenden Kunst noch so gut auskennen, für die freie Kunst müssen sie weiterhin sensibilisiert werden und offen bleiben. Als Teilnehmende an Fortbildungen und Kunstaktionen sollen sie ihren Blick weiten. Lehrkräfte sollen lernen, noch mehr aber sollen sie kennenlernen. Nur so können sie selbst erkennbar Treppensteigende bleiben, immer beweglich treppauf und treppab, können das pädagogische Potenzial in der Kunst erkennen, ohne es zu forcieren, und nicht verzweifeln, wenn es ausbleibt. Sie können sich selbst vor dem Reinfall bewahren, indem sie die Vielfalt fördern. Sie können in verschiedene Richtungen schauen und den Funken erkennen, wenn er überspringt, ohne gleich die Brandschutzverordnung zu zitieren. Und so können sie auch ganz flexibel wieder den Draufblick gewinnen, die Treppe ganz nach oben rennen und ohne falsche Scheu die ihnen zugeschriebene Autorität einnehmen und den Feuerlöscher von der Wand, gerade dann, wenn sonst alles abzufackeln droht.

- Bracher, Daniel und Njezic, Petra (2023): Raumlabor Artists in Residence an der Schule Uerkheim 2023. Video: muehlwerk.ch. https://www.ag.ch/de/themen/kultur-sport/kultur/kultur-macht-schule/artists-in-residence?dc=c60af432-5854-446f-bd2b-518c45a045d6_de ↩︎
- Kagerer, Hildburg (1991): Das Fremde hört nicht auf. In: Neue Sammlung 31, Heft 4, S. 592f. ↩︎
- Erich Kästner (1969): Ansprache zum Schulbeginn. In: Gesammelte Schriften für Erwachsene. Bd. 7. München/Zürich, S. 180ff. ↩︎
- Ebd. ↩︎
- Liebau, Eckart (2009): Schulkünste. In: Die Kunst der Schule. Über die Kultivierung der Schule durch die Künste, transcript Verlag Bielefeld, S. 54. ↩︎
- Herzberg, Anja (2025, 04.10.): Integration ist bei uns Alltag. https://www.bpb.de/lernen/kulturelle-bildung/60140/integration-ist-bei-uns-alltag/ ↩︎
| Am 23. August feierte Kultur macht Schule sein Jubiläum in der Alten Reithalle in Aarau. Im Zentrum der Fachtagung zur kulturellen Bildung standen grundlegende Fragen: Welche Rolle soll Kultur heute und künftig in der Schule spielen? Was funktioniert bereits gut – und wo besteht Handlungsbedarf? Die Tagung wurde gemeinsam mit der Geheimen Dramaturgischen Gesellschaft entwickelt und von ihr geleitet. Am Abend wurde ein breites Kulturprogramm angeboten. Gemeinsam mit langjährigen Partnerinnen und Partnern aus Kultur, Bildung, Politik und Gesellschaft blickte Kultur macht Schule auf zwei Jahrzehnte engagierte Arbeit zurück. Mehr als 200 Personen nahmen an den beiden Veranstaltungen teil und setzten damit ein starkes Zeichen für die Bedeutung kultureller Bildung. Mehr zum Jubiläum |
Gefällt Ihnen dieser Artikel? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter um stets über neue Blogbeiträge informiert zu sein.
